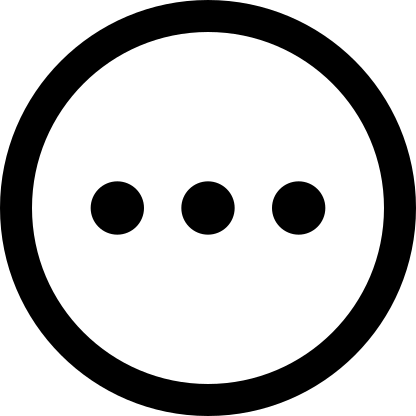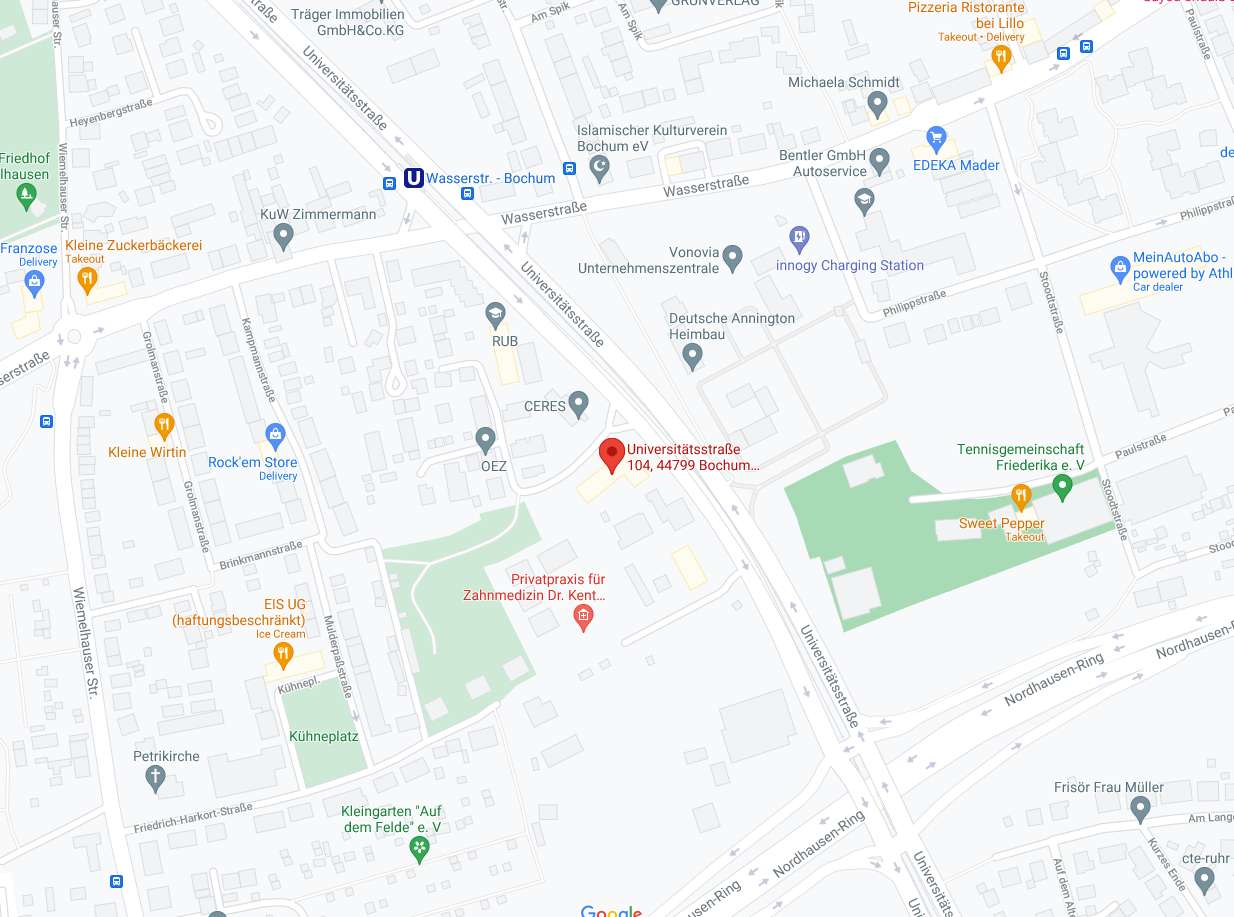Jenaplan
Wie ist der Jenaplan entstanden?
Jenaplan ist ein ganzheitliches reformpädagogisches Bildungskonzept, das vom Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Peter Peterson im Jahre 1927 begründet wurde. Er war Leiter der Universitätsschule Jena und konzipierte eine Übungsschule, in der er sein schulpädagogisches Konzept entwickelte, erprobte und weiterentwickelte. Infolge des Nationalsozialismus und der anschließenden Nachkriegszeit wurden alle bis dahin entstandenen Jenaplan-Schulen geschlossen und erst wieder in den 60er Jahren vor allem durch Schulpädagogen in den Niederlanden und in Nordrhein-Westphalen wiederbelebt. In den 80er Jahren wurden 20 allgemein anerkannte Basisprinzipiendes Jenaplan-Konzepts aufgestellt, die sich mit dem Menschen als Individuum, der Wichtigkeit der Gesellschaft und der Schule als einen Bildungs- und Lebensraum auseinandersetzen1
![]()
Übungsschule Jenaplan, Quelle: Peter-Petersen-Archiv in Vechta
Was ist der Kerngedanken der Jenaplan-Pädagogik?
Die 20 Basisprinzipien:
Die 20 Basisprinzipien des Jenaplan-Konzepts heben die Einzigartigkeit des Menschen hervor und betonen das Recht eines jeden Individuums auf die Entwicklung einer eigenen Identität – unabhängig seiner ethnischen Herkunft, Nationalität, Behinderung, Lebensanschauung oder Religion. Der Mensch soll als eine Person in ihrer Ganzheit betrachtet und anerkannt werden. Die Entwicklung der eigenen Identität sollte durch ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit, kritischem Bewusstsein, Kreativität und sozialer Gerechtigkeit gekennzeichnet sein. In diesem Zuge sollen die Menschen an einer Gesellschaft arbeiten, in der alle Menschen gerecht und friedlich mit individuellen Unterschieden umgehen – eine Gesellschaft, die die Würde des Menschen achtet, seine Einzigartigkeit unterstützt und Anreize für die Identitätsentwicklung bietet. Der dritte Themenkomplex der Basisprinzipien umfasst die Schule als einen Bildungs- und Lebensraum, in dem dieAussagen über den Menschen als Individuum und einer gerechten und identitätsfördernden Gesellschaft gelebt und als pädagogischer Ausgangspunkt gesetzt werden.
Die drei Kerngedanken:
Nach Peterson sollen sich Kinder in möglichst großer Freiheit zu selbstbestimmten Menschen entwickeln. Das selbsttätige Arbeiten wird als ein Kerngedanke hervorgehoben. Dieses soll jedoch in einem tgemeinschaftlichen Zusammenarbeiten und -leben entwickelt werden – in und durch die Gesellschaft – in der Verantwortung für die Mitmenschen erlernt werden soll. Die Schule wird als ein Bildungs- und Lebensraum verstanden, der gemeinschaftlich von Lehrern, Eltern und Schülern gestaltet wird. Er soll nicht nur Raum für das Lernen schaffen, sondern auch Platz für Gespräche, Spiel und Feier bieten.
Die vier Bildungsgrundformen:
Diese vier Bildungsgrundformen bzw. Säulen – Gespräch, Arbeit, Spiel und Feier – bilden die Elemente eines gemeinschaftlichen Schullebens und des entdeckenden Lernens. Sie wechseln sich im Schulalltag ab und bestimmen einen kindgerechten Tagesrhythmus.
Wie gestaltet sich der Lehrplan und die Unterrichtsformen?
Da die meisten Jenaplan-Schulen staatliche Schulen sind, werden die Unterrichtsarbeit und deren Inhalte durch die jeweiligen Lehrpläne der Länder bestimmt. Somit ist eine Vergleichbarkeit mit den öffentlich staatlichen Schulen möglich und ein staatlich anerkannter Schulabschluss erreichbar. Das Besondere des Jenaplans ist die Umsetzung dieses Lehrplans, wobei das Unterrichtskonzept, die Umsetzung der Basisprinzipien und die Unterrichtsinhalte sehr flexibel gestaltet werden können. Anstelle einer traditionellen inhaltlichen Gliederung durch Fächer folgt der Jenaplan einer offenen Lernsituation, die die individuellen Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler fördern soll. Ebenso wird eine organisatorische Gliederung nach Jahrgangsklassen und 45-minütigen Stundeneinheiten vermieden. Auch wenn die Unterrichtsgestaltung sehr flexibel und individuell umsetzbar ist, finden sich klassische Jenaplan-Komponenten, die dieses Schulkonzept auszeichnen.
Die Stammgruppen:
Grundlegende Einheit an Jenaplan-Schulen ist die Arbeit in Stammgruppen– jahrgangsübergreifende Lerngruppen, in der Schüler verschiedener Altersgruppen jeden Tag mindestens 100 Minuten gemeinsam lernen und sich gegenseitig unterstützen. Im Durchschnitt befinden sich 20 Schüler unterschiedlichen Alters in einer Stammgruppe. Mithilfe dieses Konzepts soll das Helfersystem unter den Schülern gestärkt werden. Sie sollen Verantwortung für das eigene Lernen und das der Mitschüler übernehmen, Rücksicht aufeinander nehmen und ein wachsendes Verständnis für die Einzigartigkeit des Menschen aufbauen. Typischerweise werden insgesamt drei Jahrgänge gemischt, sodass die Stammgruppen folgendermaßen aussehen können:
- Vorschulgruppe: 2 – 6 Jahre
- Untergruppe: 1. – 3. Jahrgang
- Mittelgruppe: 4. – 6. Jahrgang
- Obergruppe: 7. – 9. Jahrgang
- Obergruppe: 10. Jahrgang (kein altersgemischtes Lernen, Vorbereitung auf die Realschulprüfung)
- Oberstufe: 11. – 13. Jahrgang
Die Umsetzung kann jedoch zwischen den Schulen variieren, da sich die Jenaplan-Schulen in ihren Schulformen unterscheiden. Prinzipiell lässt sich jede Schulform nach Jenaplan organisieren und auf jede Altersgruppe anwenden, egal ob Grundschule, Gymnasium oder Gesamtschule.

Schüler erforschen einen Themenbereich in Stammgruppen
Der Lernstoff wird innerhalb der Stammgruppen anhand interdisziplinär angelegter Projekte in der Gruppe erarbeitet. Die Schüler sollen einen bestimmten Themenbereich ohne Einschränkungen entdecken, sich selbst austesten und eigenmotiviert lernen. Diese selbsttätige fächerübergreifende Gruppenarbeit ist die häufigste Arbeitsweise innerhalb des Jenaplan-Konzepts. Ein weiterer Teil der Arbeitszeit wird als Freie Arbeit gestaltet, in der sich die Schüler ein Fach frei auswählen können und selbstständig bearbeiten. Um grundlegendes Basiswissen in allen Fächern zu gewährleisten, findet ein weiterer Teil der Schulwoche im Kursunterricht statt. Dieser entspricht am ehesten dem Regelunterricht des klassischen Schulsystems, da die Schüler innerhalb ihrer Altersklasse in bestimmten Fächern von Fachlehrern instruiert werden und grundlegende Fachinhalte vermittelt bekommen.
Das Gespräch:
Ein weiteres zentrales Element von Jenaplan ist das Gespräch. Die in klassischen Schulformen vorherrschende frontale Sitzordnung wird durch offene Gespräche in einem Kreis ersetzt, die durch die Schüler selbst geleitet werden und die Gesprächskultur unterstützen sollen. Diese Gesprächskreise können zur Einführung, Präsentation, Auswertung und Ergebnissicherung von Projekten und Unterrichtsinhalten genutzt werden.
Das Spiel und die Feier:
Zusätzlich werden das Lernen und die Entwicklung der Schüler spielerisch unterstützt. Das Spiel innerhalb des Schulalltags soll die Entwicklung und Aufmerksamkeit insbesondere jüngerer Kinder fördern sowie Regeln für das soziale Verhalten lehren. Möglich sind Lern-, Pausen, Turn- und Schauspiele oder auch das freie Spiel. Neben dem Spiel nehmen Feiern einen wichtigen Stellenwert im Schulalltag ein und unterstützen das soziale Lernen und das Gemeinschaftsgefühl. In den meisten Jenaplan-Schulen wird in der letzten Schulstunde des Freitags der Wochenabschluss gefeiert. Diese Feiern dienen als Reflexion der Wochenarbeit und werden von den Schülern selbst gestaltet. Sie können in verschiedenen Formen realisiert werden, bspw. als Gruppen-, Team- oder Schulfeiern, an denen auch die Eltern teilnehmen können. Regelmäßige Monatsfeiern kennzeichnen ebenfalls das Konzept von Jenaplan. Auch hier können verschiedene Formen, wie die Schüler-, Lehrer- und Elternfeiern unterschieden werden.
Schulfeier am Jenaplan-Gymnasium Nürnberg, Quelle: http://www.jenaplangymnasium.de/
Der rhythmisierte Wochenarbeitsplan:
Die verschiedenen Arbeits- und Gesprächsformen werden in einem rhythmischen Wochenplan gestaltet. Die rhythmisierte Schulwoche beginnt meist mit einem Morgenkreis oder auch einer Feier zur Wocheneröffnung, in denen die Arbeitsschwerpunkte der Woche besprochen werden und endet mit der besagten Wochenabschlussfeier. Der Wochenarbeitsplan wird von Lehrern und Schülern gemeinsam gestaltet und soll die starre Einteilung in Fachstunden aufheben. Mit ihm soll ein flexibler Rahmen geboten werden, um sich innerhalb verschiedener Altersgruppen ganzheitlich mit einem Thema zu beschäftigen sowie genügend Freiraum für die Freie Arbeit an selbst gewählten Fragestellungen zu haben.
Die Schule soll den Kindern als Bildungs- und Lebensraum dienen, in denen sie sich frei entfalten können. Die Schulzimmer werden Schulwohnstube genannt und von den Kindern selbst gestaltet, sodass jeder Raum einzigartig ist. Die meisten Jenaplan-Schulen sind als Ganztagsschulen angelegt, sodass auch beispielsweise die Mittagsverpflegung und Nachmittagsaufsicht in den Händen der Schule liegt.
Einen kleinen Einblick in den Schulalltag einer ausgewählten Jenaplan-Schule bekommen Sie hier:
Wie wird der Jenaplan finanziert?
Da die meisten Jenaplan-Schulen staatlich sind und entsprechende Zuschüsse erhalten, erheben die wenigsten ein Schulgeld. Es findet sich jedoch zu jeder Jenaplan-Schule auch ein entsprechender gemeinnütziger Förderverein, der die Schulen bei der Gestaltung und Organisation unterstützt, finanzielle Hilfe bietet und Spenden organisiert. Denn die meisten Jenaplan-Schulen sind trotz staatlicher Zuschüsse auf Spenden angewiesen, um den Schulalltag in kinder- und jugendgerechter Ganztagsform zu sichern. Schulen in freier Trägerschaft, deren staatliche Zuschüsse nicht ausreichen, um den Schulbetrieb am Laufen zu halten, erheben ein Schulgeld, das nach Einkommen der Eltern sowie nach weiteren Betreuungsaspekten (wie Nachmittagsunterricht) gestaffelt ist. Extras wie Verpflegung können weitere Kosten verursachen. Einen vollständigen Überblick über die entstehenden Kosten erhalten Sie am besten direkt an der entsprechenden Schule.
Wie weit verbreitet ist die Jenaplan-Pädagogik?
Derzeit gibt es rund 40 Jenaplan-Schulen in Deutschland. Diese können jede gängige Schulform annehmen und sind für jede Schulstufe ausgelegt, sei es Grundschule, Gymnasium, Hauptschule oder Gesamtschule. Die konkrete Anzahl ist nicht eindeutig bestimmbar, da einige Schulen lediglich jenaplanorientiert arbeiten. Andere wiederum nennen sich noch Jenaplan-Schule obwohl sie sich bereits vom Jenaplan entfernt haben. Eine nicht vollständige Auflistung deutscher Jenaplan-Schulen finden Sie unter: http://www.jenaplan.eu/schulen/in-deutschland/index.html. Vor allem in den Niederlanden ist dieses reformpädagogische Konzept sehr weit verbreitet, mit einer höheren Anzahl an Jenaplan-Schulen als in Deutschland.
Anerkennung
Leistungsbeurteilung:
Statt einer „bloßen“ Zensierung erhalten die Schüler einen Arbeits- und Leistungsbericht bzw. einen Lernentwicklungsbericht, der auf drei Bewertungsmaßstäben basiert. Während der „Stammgruppenlehrer“ die Verantwortung für die Leistungsbeurteilung trägt, entstehen diese jedoch in Kommunikation mit den Schülern. Die Selbstreflexion und die Einschätzung durch die Mitschüler sind ein wichtiger Bestandteil in der Beurteilung der Schüler. Lernstand und Lernfortschritte werden analysiert und beobachtet und bilden die Basis für eine Lernprozessbegleitung. Persönliche Leistungen werden als individueller Lernfortschritt betrachtet. Somit bildet das Kind selbst die Bezugsnorm, sodass der Schüler in seiner Beurteilung nur mit sich selbst verglichen und schulischer Leistungsdruck sowie Konkurrenzdenken innerhalb einer Gruppe gemindert werden. Durch diese individuelle Bezugsnorm kann jedes Kind schulischen Erfolg erleben, der in schriftlichen Rückmeldungen seitens des Lehrers gewürdigt wird und gleichzeitig neue Perspektiven und Herausforderungen aufzeigt. Dies soll Motivation für neues und intensives Lernen wecken. Die Schüler sollen nicht für eine Note, sondern für ein bestimmtes Arbeitsziel lernen wollen. Die meisten Jenaplan-Schulen führen eine zusätzliche Ziffernbenotung ab einer bestimmten Jahrgangsstufe ein, da viele Jenaplan-Schulen zum Teil staatliche Schulen der gängigen Schulformen sind und den entsprechenden Bedingungen des Landes unterliegen. So werden beispielweise Schüler der Jenaplan-Schule in Jena ab dem 7. Schuljahr auch mit Zensuren benotet und erhalten dementsprechend ein Zeugnis mit Zensuren sowie einer verbalen Beurteilung.
Schulabschlüsse:
Jenaplan-Schulen ermöglichen in der Regel den gängigen Schulabschluss der jeweiligen Schulform, sodass Haupt- und Realschulabschluss sowie das Abitur erreicht werden können. Dafür ist wie auch im klassischen Schulsystem das Ablegen zentraler Prüfungen erforderlich. Private, staatlich genehmigte Jenaplan-Schulen ermöglichen ihren Schülern ebenfalls einen gängigen Schulabschluss, der als externe Prüfung absolviert werden muss.
Weiterführende Informationen zur Jenaplan-Pädagogik finden Sie unter:
Gesellschaft für Jenaplanpädagogik in Deutschland e.V.
jenaplan-heute.de
Fragen & Antworten
Ja, bei tutoria bieten wir die Möglichkeit eines Probeunterrichts an, um sicherzustellen, dass unsere Nachhilfeleistungen den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes entsprechen. Der Probeunterricht ermöglicht es uns, den Lernbedarf Ihres Kindes besser zu verstehen und einen passenden Nachhilfelehrer auszuwählen. In diesem ersten Treffen kann Ihr Kind den Nachhilfelehrer kennenlernen, Fragen stellen und erste Lernerfolge erzielen.
Unsere Nachhilfestunden dauern in der Regel 2x 45 Minuten. Diese Zeitspanne ermöglicht eine effiziente und konzentrierte Lernsituation, die es unseren qualifizierten Nachhilfelehrern ermöglicht, den Lehrstoff optimal zu vermitteln und individuelle Fragen zu beantworten.
Wir verstehen, wie wichtig eine vertraute Umgebung für den Lernprozess ist, daher findet bei tutoria die Nachhilfe immer bei Ihnen zu Hause statt. Unsere qualifizierten Nachhilfelehrer kommen direkt zu Ihnen nach Hause, um eine Lernumgebung zu schaffen, in der Ihr Kind sich wohl fühlt und sich gut konzentrieren kann.
Die Kosten für eine Nachhilfestunde bei tutoria variieren je nach der gewünschten Dauer und Laufzeit der Nachhilfe. Der Preis für eine 45 Minuten Einheit beginnt ab 19,90€. Wir sind stolz darauf, eine faire Preisgestaltung anzubieten, die es unseren Schülern und ihren Familien ermöglicht, die für sie passende Nachhilfeleistung zu finden.
Bei tutoria sind unsere Nachhilfelehrer sorgfältig ausgewählt und verfügen über umfassende Qualifikationen, um sicherzustellen, dass Ihr Kind die bestmögliche Unterstützung erhält. Unsere Nachhilfelehrer sind erfahren darin, den Lehrstoff effektiv zu vermitteln und auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Außerdem sind sie Experten in ihren Fachgebieten und haben nachweislich umfassende Kenntnisse in den relevanten Schulfächern. Sie sind in der Lage, den Lehrstoff verständlich zu erklären und Lernstrategien zu vermitteln, die zu nachhaltigem Erfolg führen.