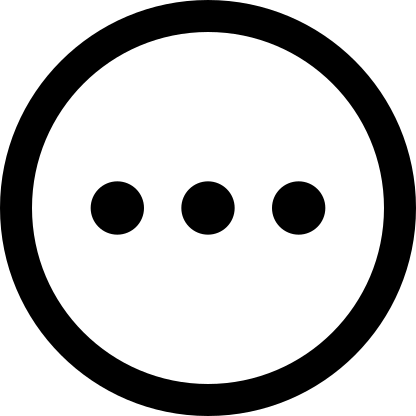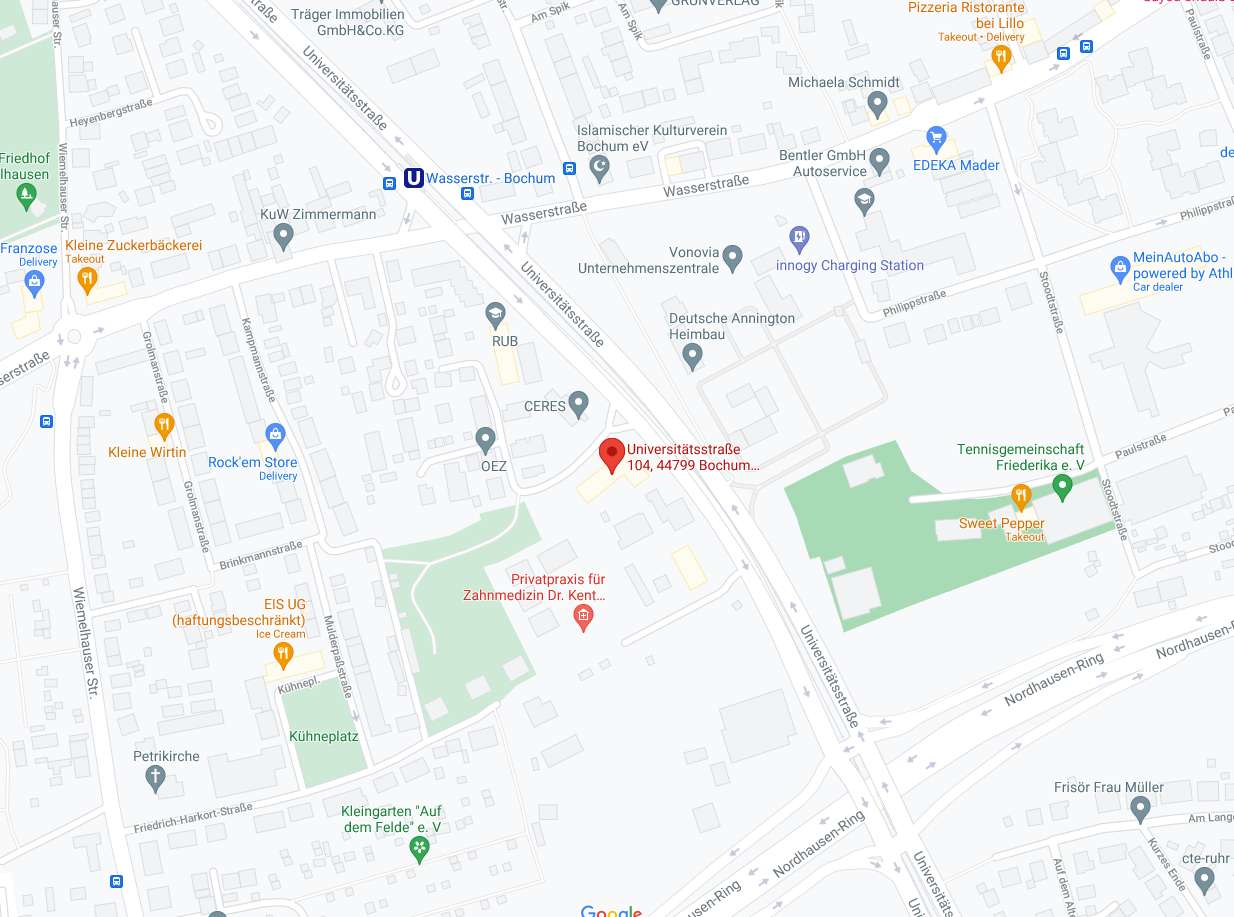Texte strukturieren
1. Was ist eine Textstruktur?
Wenn wir nach der Textstruktur fragen, dann fragen wir nach der Art und Weise, wie Sätze in einem Text miteinander verknüpft werden.
2. Wiederaufnahmestruktur
Ein wirksames Mittel, Sätze aufeinander zu beziehen, ist das Mittel der Wiederaufnahme. Das bedeutet, der nachfolgende Satz nimmt ein Wort des vorherigen Satzes auf.
Das kann entweder dasselbe Wort sein oder eins, das sich auf denselben Gegenstand oder dieselbe Person bezieht.
- Wiederaufnahme durch Wiederholung
Peter lief nach Hause. Peter hatte Angst.
- Wiederaufnahme durch Personalpronomen (oder andere Pronomen)
Peter lief nach Hause. Peter hatte Angst.
- Wiederaufnahme durch ein Wort, das sich auf dieselbe Person bezieht (externes Synonym)
Peter lief nach Hause. Er hatte Angst.
- Wiederaufnahme durch Teil- Ganzes- Beziehung
Das Zimmer war sehr schön. Die Fenster waren weit geöffnet und die Sonne erhellte den Raum.
Die Fenster sind also ein Teil des Zimmers als Ganzes.
Beachte: Die Wiederaufnahme muss immer eindeutig sein.
Beispiel:
- Roland ist mir Peter verabredet. Peter kommt nicht. (eindeutig)
- Roland ist mit Peter verabredet. Er kommt nicht. (mehrdeutig)
Unterstreiche die Wörter, die zueinander in einer Teil- Ganzes – Beziehung stehen und benenne sie!
- Der Mann kam die Straße entlang. Er lief sehr schnell.
- Die Katze lag auf dem Bett. Sie leckte sich die Pfoten. ________________________
- Martin saß auf dem Bett. Er hielt sich den Bauch vor Lachen. ________________________
- Der Papagei schimpfte. Sein Käfig war schmutzig. ________________________
- Die Straßenbahn bremste. Die Fahrgäste fielen nach vorn. ________________________
- Hans fiel hin. Er hatte sich leicht verletzt. ________________________
- Das Fest ging lange. Es hat uns sehr gut gefallen. ________________________
- Die Katze ging in den Wald. Dort fand das Tier Unterschlupf vor dem Regen. ________________________
„Er“ bezieht sich auf „der Mann“.
Setze sinnvolle Wiederaufnahmemittel ein!
- Judith lädt Larissa auf eine Party ein.
- Timm versucht, das Rätsel zu lösen.
- Martin brachte die Getränke mit.
- Es hatte geregnet. Deshalb war die Straße nass.
- Anja ist die Treppe zu schnell hinunter gerannt. ________________________ hat sie sich den Fuß verstaucht.
- Ruth hatte Geburtstag. ________________________ hatten wir leider nicht gedacht.
- Zuerst muss du die DVD einlegen. ________________________ drückst du auf START.
- „Du bist schon wieder zu spät gekommen. ________________________ hast du die Hausaufgaben vergessen!“
- Er sollte auf sein Gewicht achten. ________________________ fährt er immer nur mit dem Auto zur Arbeit.
________________________ verspricht, zu kommen.
________________________ gelingt ihm nach 20 Minuten.
Wie haben ________________________ ausgetrunken.
3. Satzverknüpfungen
Häufig werden Sätze miteinander durch Konjunktionen und Konjunktionaladverbien miteinander verknüpft.
Setze die passenden Konjunktionaladverbien ein!
dabei – trotzdem – außerdem – daran – danach
4. Gliederung eines Textes
Passagen eines Textes müssen sinnvoll gegliedert werden.
- Block
Dies ist eine sehr häufige Gliederung. Der Text besteht dann aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schlussteil.
- Erörterung
Diese Form eignet sich, wenn du Vor- und Nachteile abwiegen möchtest. In diesem Fall besteht der Text aus einer Einleitung, einem Hauptteil (aufgeteilt in Pro-Argument und Contra-Argumente) und der Schlussfolgerung.
5. Nützliche Wörter und Redewendungen
Im Folgenden findest du einige Beispiele. Sie können dir helfen, dich präziser auszudrücken und einen Text abwechslungsreich zu gestalten.
- Für den Anfang
Im Folgenden …
Ich möchte untersuchen, ob …
Ich möchte beweisen, dass …
Zu Beginn …
Als Erstes …
Anfangs/eingangs …
- Für den Hauptteil
Dafür/dagegen spricht, (dass) …
Einerseits … andererseits …
Außerdem/weiterhin …
Allerdings …
Ein weiteres Argument …
Im Anschluss …
Danach/nachdem/ …
Wie bereits erwähnt …
- Für den Schlussteil
Es hat sich gezeigt, (dass) …
Abschließend …
Zum Abschluss/Ende …
Schließlich …
Daraus folgt, (dass) …
Es konnte bewiesen werden, (dass) …
Deswegen/daher/somit …
Daraus folgt …
6. Lösungen zu den Übungen
Zu 2
Pfoten / Katze, Martin / Bauch, Papagei / Käfig, Straßenbahn / Fahrgäste, Hans / Er, Das Fest/es, Die Katze / das Tier
Sie/Larissa verspricht zu kommen.
Es gelingt ihm nach 20 Minuten.
Wir haben sie/die Getränke ausgetrunken.
Zu 3
Anja ist die Treppe zu schnell hinunter gerannt. Dabei hat sie sich den Fuß verstaucht.
Ruth hatte Geburtstag. Daran hatten wir leider nicht gedacht.
Zuerst muss du die DVD einlegen. Danach drückst du auf START.
„Du bist schon wieder zu spät gekommen. Außerdem hast du die Hausaufgaben vergessen!“
Er sollte auf sein Gewicht achten. Trotzdem fährt er immer nur mit dem Auto zur Arbeit.
Textverständnis
Warum wir Texte verstehen
1. Inhaltlicher Zusammenhang
Wir verstehen Texte genau dann, wenn sich die Textbausteine logisch aufeinander beziehen.
Wenn sich die Sätze eines Textes logisch aufeinander beziehen, können wir den Text als inhaltlich zusammenhängend bezeichnen.
2. Kohärenzmittel
Ist ein Text inhaltlich zusammenhängend, bezeichnen wir ihn auch als kohärent.
Die Mittel, die einen Text kohärent machen, bezeichnen wir als Kohärenzmittel.
Du kennst bereits einige Kohärenzmittel:
- Satzverknüpfungen (weil, deshalb, dennoch, trotzdem …)
- Wiederaufnahmemittel (Wortwiederholung, Pronomen, externe Synonyme, ein Teil für ein Ganzes benennen)
Mehr Informationen dazu findest du im Kapitel „Textstruktur“.
3. Teste dein Wissen
Finde die Kohärenzmittel im folgenden Text!
Vom Grillen und von Räubern
Die Räuberwurst mag Hans am liebsten. Sie ist würzig, weil viele Chilistückchen drin sind. Letztens stand er im Supermarkt und konnte keine finden. Er suchte bei den Fleisch- und Wurstwaren, aber fand einfach keine Räuberwurst. Er schaute bei den Angeboten und in der Grillecke, die es im Sommer gibt, aber fand weit und breit keine. Schließlich fragte er die Verkäuferin.
„Ich habe überall nachgesehen, trotzdem konnte ich die Räuberwurst nicht finden. Haben Sie die nicht mehr?“ Sie antwortete: „Nee, die ham wa nich. Sind keene Räuber drin, desshalb darf’se nich mehr so heißen.“
Verwirrt verließ Hans den Laden. Als hätte er geglaubt, es seien Räuber in der Räuberwurst?! Und außerdem musste er jetzt was anderes zum Grillen finden.
4. Lösung
Die Räuberwurst mag Hans am liebsten. Sie (= die Wurst, Personalpronomen) ist würzig, weil (Verknüpfung) viele Chilistückchen drin sind. Letztens (zeitl. Verknüpfung) stand er (= Hans, Personalpronomen) im Supermarkt und konnte keine (= Räuberwurst, Indefinitpronomen) finden. Er (= Hans, Personalpronomen) suchte bei den Fleisch- und Wurstwaren (die Wurst als Teil der Fleisch- und Wurstabteilung als Ganzes), aber (Verknüpfung) fand einfach keine Räuberwurst (Wortwiederholung). Er (= Hans, Personalpronomen) schaute bei den Angeboten (Teil-des-Ganzen-Bezug) und in der Grillecke (Teil-des-Ganzen-Bezug), die (= Grillecke, Demonstrativpronomen) es im Sommer gibt, aber (Verknüpfung) fand weit und breit keine (= Räuberwurst, Indefinitpronomen). Schließlich (zeitl. Verknüpfung) fragte er (= Hans, Personalpronomen) eine Verkäuferin.
„Ich habe überall nachgesehen, trotzdem (Verknüpfung) konnte ich die Räuberwurst nicht finden. Haben Sie die (= Räuberwurst, Demonstrativpronomen) nicht mehr?“ Sie (= die Verkäuferin, Personalpronomen) antwortete: „Nee, die (= Räuberwurst, Demonstrativpronomen) ham wa nich. Sind keene Räuber drin, desshalb darf’se (se= sie = die Räuberwurst, Personalpronomen) nich mehr so heißen.“
Verwirrt verließ Hans den Laden. Als hätte er (= Hans, Personalpronomen) geglaubt, es seien Räuber in der Räuberwurst?! Und außerdem (Verknüpfung) musste er (= Hans, Personalpronomen) jetzt was anderes (= eine andere Wurst, Teil-des-Ganzen) zum Grillen finden.
Sender (Autor) und Empfänger (Leser)
Was will der Sender (Autor) vom Empfänger (Leser)?
1. Texte als Kommunikationsmittel
Ein Autor möchte einem Leser mittels eines Textes in der Regel etwas Bestimmtes mitteilen.
- Aufgabe des Autors ist es, einen Text vermittelbar darzustellen.
- Aufgabe des Lesers ist es, herauszufinden, was der Autor ihm mit diesem Text vermitteln möchte.
Ein Autor möchte einen Leser in der Regel zu einer bestimmten Handlung oder Reaktion bewegen. Dies kann nachdenken, sich wundern oder beispielsweise verstehen sein.
2. Die Funktion von Texten
Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Textarten. Wir unterscheiden
- fiktionale, also erdachte, Texte und
- non-fiktionale Texte
Beispiele:
- Romane, Märchen und Theaterstücke zählen zu den fiktionalen Texten.
- Sachtexte, zum Beispiel im Lexikon oder in der Tageszeitung, gehören zu den non-fiktionalen Texten. Du kannst sie leicht an ihrer sachlichen Schreibweise erkennen.
In der Regel benutzt ein Autor eine bestimmte Textart, um den Leser zu einer bestimmten Handlung oder Reaktion zu bewegen.
Sieh dir die folgenden Texte näher an. Was ist ihre Funktion?
| Verbotstext |
regelt \ Ge- und Verbote |
|
| Werbetext |
eine Handlung soll unterlassen werden |
|
|
Gebrauchsanleitung |
Information \ sachlich mitteilen |
|
|
Nachrichten |
unterhaltender, \ narrativer Text |
|
| Gesetzestext |
appelliert \ etwas zu kaufen |
|
| Gedicht | Handlungsanweisung, \ die befähigt etwas zu tun | |
| Roman | poetischer \ Text, der unterhält o.ä. | |
|
Rezept |
erklärt/regelt \ Bedingung von etwas | |
| Fabel | verschlüsselt \ eine Moral |
Beachte: Einige Texte stellen Mischformen dar.
Beispiel:
- In einer Erörterung wird sachlich argumentiert, aber auch wertend kommentiert.
- sich pudelwohl fühlen
- Wegweiser
- Rabeneltern
3. Textsorten in der Schule
Einige Texte sind besonders gebräuchlich im Schulalltag. Hier einige Beispiele:
- Aufsatz
Der Aufsatz ist eine (kurze) Abhandlung über ein bestimmtes (meist vom Lehrer vorgegebenes) Thema. Wichtig ist hier vor allem eine gute Gliederung.
- Inhaltsangabe
Ist eine knappe Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts von Texten (Ereignissen oder Filmen).
- Interpretatioz
Hier wird die Wirkung eines Textes oder Bildes untersucht. Sehr häufig ist die Gedichtinterpretation.
- Bericht
Zum Beispiel ein Erlebnisbericht über die schönsten Ferienerlebnisse. Ein Bericht muss alle wichtigen W-Fragen klären:
Wer?
Was?
Wann?
Wie?
Warum?
(Welche Folge?)
- Erörterung
Untersucht einen bestimmten Sachzusammenhang oder ein Problem. Nach dem einleitenden Teil werden die Hauptüberlegungen gut gegliedert dargestellt. Im Schlussteil werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst.
4. Sprachliche Mittel
Ein Autor muss sich um sprachliche Eindeutigkeit bemühen, um Missverständnisse zu vermeiden. In sachlichen Texten wird vornehmlich auch sehr sachliche Sprache benutzt.
Anders verhält es sich mit literarischen Texten. Hier werden häufig stilistische Mittel verwendet, um einen Text abwechslungsreich zu gestalten.
Eine der wichtigsten rhetorischen Figuren ist die Metapher. Sie verbindet zwei Dinge miteinander, die normalerweise nicht zusammengehören, und überträgt dabei die Bedeutung. Wir sprechen auch von einem bildlichen Ausdruck.
Beispiele:
Benutzen wir das Wort „wie“ um zwei Dinge zu verbinden, sprechen wir auch von einem Vergleich.
Beispiele:
- Ein Mensch, wie ein Fels in der Brandung.
- Ein Mensch, so listig wie ein Fuchs.
Überlege dir nun selbst Vergleiche und ergänze das Gedicht!
Ich wünsche mir einen Menschen, der wie ein ___________ zu mir ist.
Einen Menschen, der mir zuhört wie ein __________.
Einen Menschen, mit dem ich still beisammen sein kann wie ein ___________.
Er würde mit seinem ___________ Trauer von mir fern halten und ___________
spenden vor meiner Verzweiflung.
Und auch ich selbst möchte für diesen Menschen ein ____________ sein,
ihn mit meinen __________________ sacht umfangen und ihn, wenn er unruhig ist,
mit dem sanften Rauschen meiner ___________________in den Schlaf singen.
Und unser Vertrauen, unsere Liebe, unser Beisammensein sollte wachsen, sich
verwurzeln und doch immer neu sein,
wie das Kleid eines _______________,das Jahr um Jahr abwirft und von neuem
kraftvoll und schön hervorbringt.
5. Eindeutig zweideutig
In Gebrauchs- und Nachrichtentexten muss der Autor versuchen, die Nachricht möglichst eindeutig zu formulieren, damit sie von dem Leser auch verstanden werden kann.
Die folgenden Beispiele zeigen dir, dass es den Autoren von Texten nicht gelungen ist, sich eindeutig auszudrücken. Versuche, herauszufinden, was die Kunden einer Versicherungsfirma ausdrücken wollten und verbessere die Aussagen!
- Einnahmen aus der Viehhaltung haben wir keine. Mit dem Tod meines Mannes ging das letzte Rindvieh vom Hof.
________________________
________________________ - Dummerweise stieß ich mit dem Fußgänger zusammen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, und bedauerte dies sehr
________________________
________________________ - Durch den Auffahrunfall wurde das Hinterteil meines Vordermannes verknittert.
________________________
________________________ - Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie dieses Schreiben nicht erhalten haben.
________________________
________________________
6. Lösungen zu den Übungen
Zu 2
Verbotstext: eine Handlung soll unterlassen werden.
Werbetext: appelliert etwas zu kaufen.
Gebrauchsanleitung: erklärt/regelt Bedingung von etwas
Nachrichten: Information sachlich mitteilen
Gesetzestext: regelt Ge- und Verbote
Gedicht: poetischer Text, der unterhält o.ä.
Roman: unterhaltender, narrativer Text
Rezept: Handlungsanweisung, die befähigt etwas zu tun
Fabel: verschlüsselt eine Moral
Zu 4
Hier ist deine Fantasie gefragt!
Zu 5
Einnahmen aus der Viehhaltung haben wir keine. Seit dem Tod meines Mannes betreiben wir keine Rinderzucht.
Dummerweise stieß ich mit einem Fußgänger zusammen. Dieser wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Ich bedauere diesen Vorfall sehr.
Durch den Auffahrunfall wurde das Heck des vorderen Autos beschädigt.
Bitte benachrichtigen Sie mich über den Erhalt dieses Schreibens.
Fragen & Antworten
Ja, bei tutoria bieten wir die Möglichkeit eines Probeunterrichts an, um sicherzustellen, dass unsere Nachhilfeleistungen den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes entsprechen. Der Probeunterricht ermöglicht es uns, den Lernbedarf Ihres Kindes besser zu verstehen und einen passenden Nachhilfelehrer auszuwählen. In diesem ersten Treffen kann Ihr Kind den Nachhilfelehrer kennenlernen, Fragen stellen und erste Lernerfolge erzielen.
Unsere Nachhilfestunden dauern in der Regel 2x 45 Minuten. Diese Zeitspanne ermöglicht eine effiziente und konzentrierte Lernsituation, die es unseren qualifizierten Nachhilfelehrern ermöglicht, den Lehrstoff optimal zu vermitteln und individuelle Fragen zu beantworten.
Wir verstehen, wie wichtig eine vertraute Umgebung für den Lernprozess ist, daher findet bei tutoria die Nachhilfe immer bei Ihnen zu Hause statt. Unsere qualifizierten Nachhilfelehrer kommen direkt zu Ihnen nach Hause, um eine Lernumgebung zu schaffen, in der Ihr Kind sich wohl fühlt und sich gut konzentrieren kann.
Die Kosten für eine Nachhilfestunde bei tutoria variieren je nach der gewünschten Dauer und Laufzeit der Nachhilfe. Der Preis für eine 45 Minuten Einheit beginnt ab 19,90€. Wir sind stolz darauf, eine faire Preisgestaltung anzubieten, die es unseren Schülern und ihren Familien ermöglicht, die für sie passende Nachhilfeleistung zu finden.
Bei tutoria sind unsere Nachhilfelehrer sorgfältig ausgewählt und verfügen über umfassende Qualifikationen, um sicherzustellen, dass Ihr Kind die bestmögliche Unterstützung erhält. Unsere Nachhilfelehrer sind erfahren darin, den Lehrstoff effektiv zu vermitteln und auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Außerdem sind sie Experten in ihren Fachgebieten und haben nachweislich umfassende Kenntnisse in den relevanten Schulfächern. Sie sind in der Lage, den Lehrstoff verständlich zu erklären und Lernstrategien zu vermitteln, die zu nachhaltigem Erfolg führen.