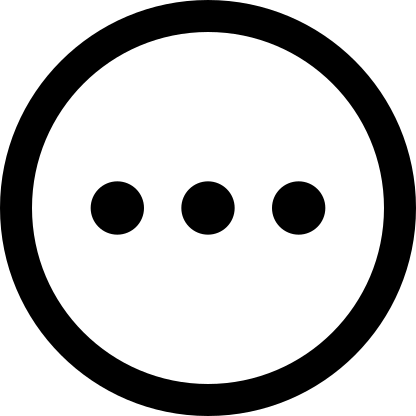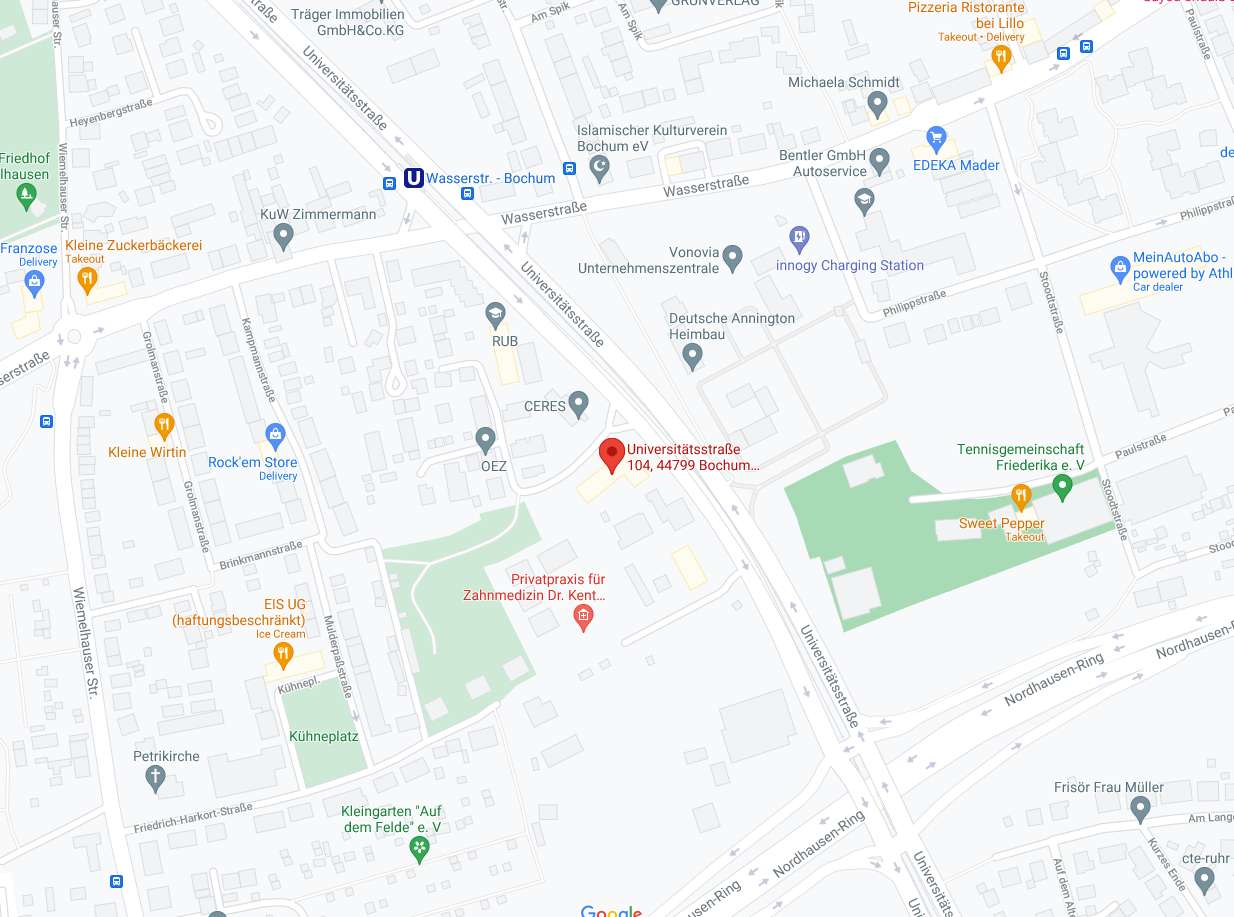Herkunft und Verwendung der Kasus im Lateinischen
Herkunft und Verwendung der Kasus im Lateinischen
Vorbemerkung: Der Begriff „casus“ – Fall ist eine Lehnübersetzung des griechischen πτῶσις gleicher Bedeutung. Der Begriff entstammt dem antiken Schulwesen, als der Lehrer mit Hilfe der Beugung eines Stifts seine Schüler Wörter deklinieren ließ.
Das Indogermanische kennt 8 Kasus, die nur im Sanskrit erhalten geblieben sind. In allen anderen Sprachen trat ein gewisser Kasussynkretismus auf, d.h. einige Kasus sind ineinander gefallen.
Ursprünglich gab es keine Präpositionen. Diese entwickelten sich erst nach Zusammenfall der Kasus in den Einzelsprachen. Im Griechischen kann man deshalb noch – wenn man mit den Präpositionen unsicher ist – auf den davon abhängigen Kasus achten. Im Lateinischen ist dies zwar großenteils auch noch so, z.B. „cum“ mit instrumentalem Ablativ oder „per“ und „ad“ mit direktivem Akkusativ, aber es gibt daneben auch logische Ausnahmen wie „apud“ mit Akkusativ statt zu erwartetem Ablativus locativus.
Im Lateinischen gibt es noch 6 Kasus.
Die starken Kasus:
- Nominativ
- Akkusativ
- Vokativ
Die schwachen Kasus:
- Genetiv
- Dativ
- Ablativ
Funktionen der lateinischen Kasus
Nominativ: Subjekt
Genitiv: Kasus der Herkunft, Zugehörigkeit, des Bereichs und teilweise der Ursache Überschneidung mit Ablativusseparativus
Die Endung – i der o-Deklination ist eine italische Neuerung.
Dativ: „freundlicher Dativ“ nach Verben wie „geben, helfen“, Kasus des Interesses Dativuscommodi, des nicht direkt betroffenen „Objekts“
Person im Dativ und Form von „esse“ → Dativus possessivus
Akkusativ: Objekt, Richtung, logisches Subjekt des AcI
Ablativ: entstanden aus 3 indogermanischen Kasus:
- Instrumental: Begleiter Person oder Sache, Art und Weise; oft mit der Präposition „cum“, Unterarten des Instrumentals wie der Ablativus Modalis stehen oft ohne Präposition und sind deshalb schwer zu übersetzen
- Separativus: Herkunft, oft mit der Präposition „exx“
- Locativus: Ort und Zeit
Vokativ: direkte Anrede, oft nach der Partikel „o“
Fragen & Antworten
Ja, bei tutoria bieten wir die Möglichkeit eines Probeunterrichts an, um sicherzustellen, dass unsere Nachhilfeleistungen den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes entsprechen. Der Probeunterricht ermöglicht es uns, den Lernbedarf Ihres Kindes besser zu verstehen und einen passenden Nachhilfelehrer auszuwählen. In diesem ersten Treffen kann Ihr Kind den Nachhilfelehrer kennenlernen, Fragen stellen und erste Lernerfolge erzielen.
Unsere Nachhilfestunden dauern in der Regel 2x 45 Minuten. Diese Zeitspanne ermöglicht eine effiziente und konzentrierte Lernsituation, die es unseren qualifizierten Nachhilfelehrern ermöglicht, den Lehrstoff optimal zu vermitteln und individuelle Fragen zu beantworten.
Wir verstehen, wie wichtig eine vertraute Umgebung für den Lernprozess ist, daher findet bei tutoria die Nachhilfe immer bei Ihnen zu Hause statt. Unsere qualifizierten Nachhilfelehrer kommen direkt zu Ihnen nach Hause, um eine Lernumgebung zu schaffen, in der Ihr Kind sich wohl fühlt und sich gut konzentrieren kann.
Die Kosten für eine Nachhilfestunde bei tutoria variieren je nach der gewünschten Dauer und Laufzeit der Nachhilfe. Der Preis für eine 45 Minuten Einheit beginnt ab 19,90€. Wir sind stolz darauf, eine faire Preisgestaltung anzubieten, die es unseren Schülern und ihren Familien ermöglicht, die für sie passende Nachhilfeleistung zu finden.
Bei tutoria sind unsere Nachhilfelehrer sorgfältig ausgewählt und verfügen über umfassende Qualifikationen, um sicherzustellen, dass Ihr Kind die bestmögliche Unterstützung erhält. Unsere Nachhilfelehrer sind erfahren darin, den Lehrstoff effektiv zu vermitteln und auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Außerdem sind sie Experten in ihren Fachgebieten und haben nachweislich umfassende Kenntnisse in den relevanten Schulfächern. Sie sind in der Lage, den Lehrstoff verständlich zu erklären und Lernstrategien zu vermitteln, die zu nachhaltigem Erfolg führen.